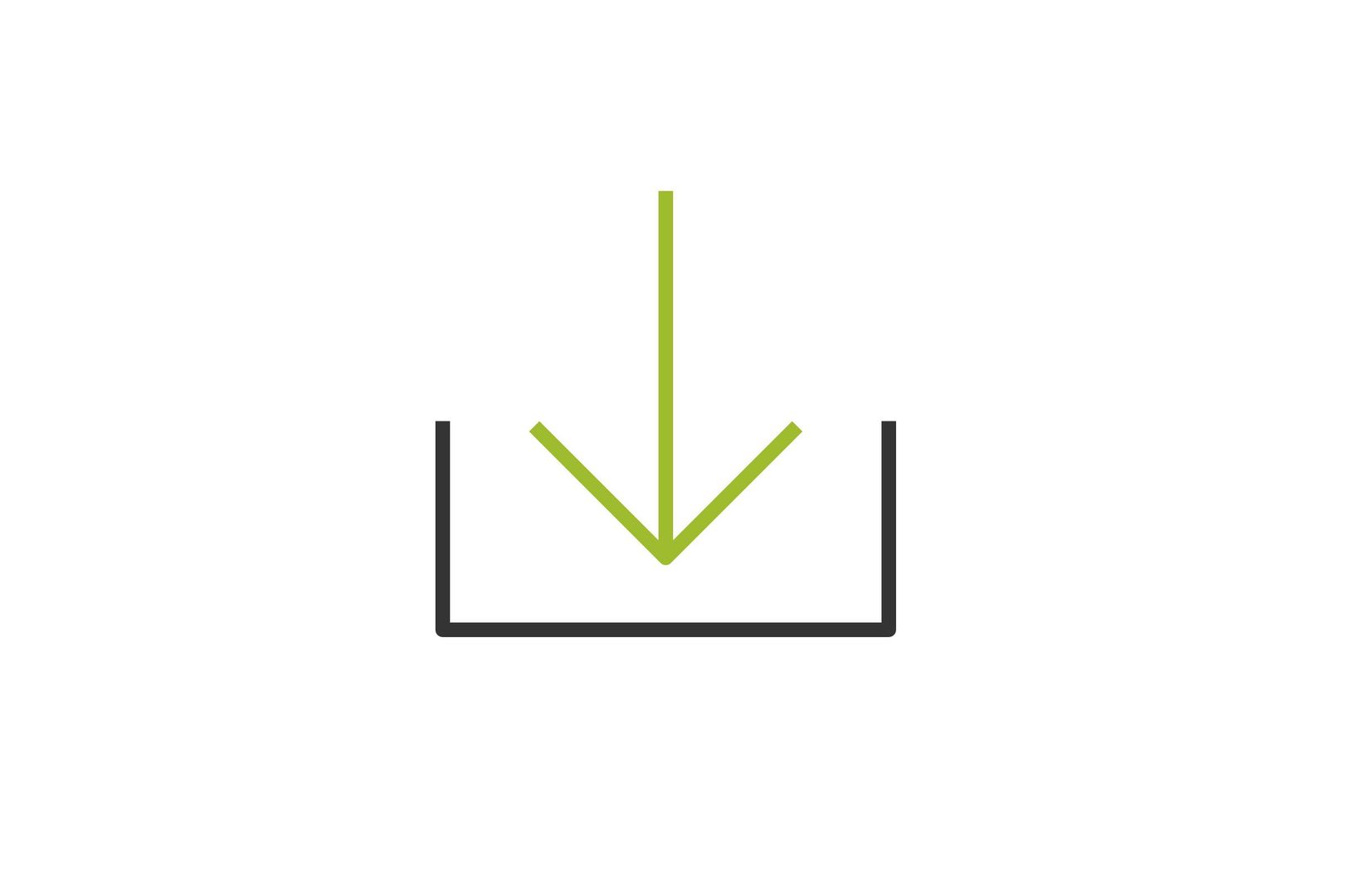Was ist ein Kapazitätsmarkt?
Definition
Mit der Veröffentlichung des Weißbuchs "Ein Strommarkt für die Energiewende" des Bundeswirtschaftsministeriums ging eine deutliche Absage zur diskutierten Schaffung eines Kapazitätsmarkts einher (z.B. "Kapazitätsmärkte sind anfällig für Regulierungsfehler und erschweren die Transformation des Energiesystems", S. 4). Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass das deutsche Stromsystem in Zukunft einen Kapazitätsmarkt beinhalten wird. Auch im Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz), das zum 30. Juli 2016 in Kraft getreten ist, ist die Einführung eines Kapazitätsmarkts nicht vorgesehen.
Kapazitätsmarkt und Versorgungssicherheit
In der Vergangenheit bestand eine Gemeinsamkeit bei allen Auslegungen des Begriffs "Kapazitätsmarkt": Die Diskussion stand generell im Zusammenhang mit der Diskussion um die Versorgungssicherheit von Strom. Mit einem zu schaffenden Kapazitätsmarkt sollte im Idealfall die Gefahr eines Blackouts (Totalausfall) des Stromnetzes reduziert bzw. komplett vermieden werden. Der Auslöser der Diskussionen um einen Kapazitätsmarkt war der stetig ansteigende Anteil fluktuierender Erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger mittelfristiger Abnahme von gesicherter konventioneller Erzeugung, etwa aus Atom- oder Kohlekraftwerken. Stellt man sich vor, dass an einem kalten, verhangenen Wintertag der deutsche Stromverbrauch hoch und die Solareinspeisung gering ist, benötigt man gesicherte Kapazitätsmechanismen, um den Stromverbrauch zu befriedigen. Diese gesicherten Kapazitäten müssen mit relativ kurzem Vorlauf zuschaltbar sein, etwa aus stillstehenden modernen Gaskraftwerken oder auch Biogasanlagen, um die Volatilität zu kontern.
Ein Kapazitätsmarkt könnte die Vorhaltung dieser Stromerzeugungskapazitäten ausschreiben und in freiem Wettbewerb bepreisen. Nun herrscht jedoch bei vielen weiteren Fragen keine Einigkeit. Über welche Kapazitätsmechanismen sollte ein Kapazitätsmarkt verfügen, um möglichst zuverlässig und kostengünstig zuschaltbare Kapazitäten zu sichern? Sollen auch flexible Stromverbraucher an diesem potentiellen Markt teilnehmen können? Und nicht zuletzt: Brauchen wir einen Kapazitätsmarkt überhaupt? Schließlich besteht in Deutschland entgegen medial häufig geäußerten Befürchtungen momentan ein Überschuss an Stromerzeugungskapazitäten, was sich am steigenden Stromexport in Nachbarländer zeigt. Das Grünbuch des Bundeswirtschaftsministeriums zum Strommarktdesign beziffert diese Überkapazitäten auf "60 Gigawatt in dem für Deutschland relevanten Strommarktgebiet".
Kapazitätsmarkt als Kollektivsingular: Bestehende Mechanismen und Märkte
Was in der Diskussion oft übersehen wurde, ist die Vielfalt an Instrumenten, die bereits heute zur Verfügung stehen, um kurz- bis mittelfristige Flexibilitätsoptionen zu beschaffen bzw. zu vermarkten. In diesem Sinne besteht bereits heute ein Kapazitätsmarkt – wenn der Begriff als Kollektivsingular verstanden wird. Doch welche bestehenden Mechanismen bzw. Märkte genau stehen heute zur Verfügung, um kurzfristige Kapazitäten zu heben?
- Beispielsweise kann der Regelenergiemarkt als ein äußerst kurzfristig reagierender Kapazitätsmarkt verstanden werden, da die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) über den Regelenergiemarkt Zugriff auf sehr schnell zu- oder abschaltbare Kapazitäten haben – bis in den Sekundenbereich hinein. Negative Regelenergie wird bei einem unerwarteten Nachfrageausfall oder einem unerwarteten Stromproduktionsüberschuss zugeschaltet. Positive Regelenergie wird entsprechend bei einem unerwarteten Anstieg der Stromnachfrage oder einer plötzlichen Mindereinspeisung von Stromerzeugern zugeschaltet. Die Regelenergie sorgt somit sehr zuverlässig und erfolgreich für die Sicherheit der deutschen Stromversorgung. Allein ausreichend ist sie allerdings nicht, da spätestens nach einer Stunde der Verantwortliche für die fehlerhafte Prognose auf Erzeuger- oder Abnehmerseite für Ersatz sorgen muss.
- Diese Absicherung des eigenen Kraftwerksausfalls oder des eigenen plötzlichen Mehrverbrauchs kann ein Akteur am Strommarkt (beispielsweise ein Stadtwerk) in bilateralen Verträgen mit anderen Akteuren schaffen. Hierbei werden Reserveabsicherungen im Rahmen von Over-the-Counter-Geschäften (OTC) fixiert. Vorteil für Vertragsteilnehmer dieses Kapazitätsmechanismus ist die individuelle vertragliche Ausgestaltung.
- Außerdem stellt der Intraday-Markt (Spotmarkt EPEX) eine weitere Möglichkeit dar, kurzfristig Strommengen zu kaufen bzw. zu verkaufen und somit einen Dispatch fremder Erzeugungsanlagen oder Stromverbraucher zu veranlassen. Auf dem Spotmarkt können Versorger beispielsweise ungeplante Lieferausfälle noch am selben Tag bis 30 Minuten vor Lieferung durch den Ankauf von Strom kompensieren.
- Neben diesen drei sehr marktorientierten Ansätzen steht den ÜNB die Möglichkeit zur Verfügung über die Reservekraftwerksverordnung (gemäß Artikel 6 des Strommarktgesetzes vom 26. Juli 2016 neuerdings "Netzreserveverordnung" (NetzResV)) eine Netzreserve vorzuhalten. Gemäß §13d Abs. 1 Nr. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) kontrahieren die ÜNB die Netzreserve aus zur Stilllegung angezeigten oder momentan nicht betriebsbereiten Anlagen, die sie als systemrelevant eingestuft haben, sowie aus geeigneten Anlagen im europäischen Ausland. Die Netzreserve ist jedoch nur zur Überbrückung regionaler Transportengpässe im Stromnetz vorgesehen. Mit ihr werden also Kraftwerkskapazitäten für den Redispatch der ÜNB vorgehalten, sollte ein Redispatch von im Strommarkt aktiven Kraftwerken nicht ausreichen, um zum Beispiel Windstrom aus Norddeutschland nach Süddeutschland zu disponieren. Weitere Informationen zur Netzserve finden Sie in unserem Glossar. Die von den ÜNB für jedes Winterhalbjahr ermittelten Bedarfe an Netzreserve bestätigt die Bundesnetzagentur (BNetzA) und veröffentlicht sie auf ihrer Website. :
- Im Winter 2014/15 kontrahierten die ÜNB 3.636 MW an Netzreservekapazität und im Winter 2015/16 zwischen 6.700 MW und 7.800 MW
- Für den Winter 2016/17 ist eine Kapazität von 5.400 MW in der Netzreserve gebunden
- Für den Winter 2017/2018 hat die BNetzA einen Bedarf an Netzreserve von 7.000 MW kalkuliert.
- Im Winter 2018/19 soll dieser dann auf 3.700 MW gesenkt werden.
- Für den Winter 2019/2020 beträgt der festgestellte Bedarf 1.600 MW.
- Für den Winter 2020/2021 wurde ein Bedarf an Kapazitäten aus Netzreservekraftwerken von 6.596 MW festgestellt.
- Im Winter 2022/2023 beträgt die Höhe des festgestellten Bedarfs 10.647.
- Für den Winter 2024/2025 ist der vorläufige Stand der benötigten Leistung aus Netzreservekraftwerken 8.042 MW.
- Zur weiteren Absicherung des Strommarktes wurden zusätzlich zur Netzreserve mit dem Strommarktgesetz zum 30. Juli 2016 noch die Kapazitätsreserve und die Sicherheitsbereitschaft von Braunkohlekraftwerken eingeführt. Beide Reserven sollen dann eingesetzt werden, wenn sich am Strommarkt nicht genügend Kraftwerkskapazität zur Bedienung des erwarteten Stromverbrauchs findet. Die Sicherheitsbereitschaft ist darüber hinaus aber auch ein Mittel um Deutschlands Klimaschutzziele für das Jahr 2020 zu erreichen, indem besonders klimaschädliche Braunkohlekraftwerke aus dem Markt genommen und nur noch im Bedarfsfall innerhalb von 10 Tagen hochgefahren werden. Der entscheidende Unterschied zwischen dem vormals angedachten Kapazitätsmarkt und den nun eingeführten Reserven ist, dass bei einem Kapazitätsmarkt die gesicherte Leistung von Kraftwerken honoriert worden wäre, die gleichzeitig im Strommarkt aktiv sind. In die Kapazitätsreserve und Sicherheitsbereitschaft kommen aber nur solche Anlagen, die nicht (mehr) am Markt teilnehmen, also vorläufig stillgelegt wurden.
- Nicht vergessen werden darf schließlich die europäische Harmonisierung von Strommärkten und -netzen. Auch sie dient schon heute einem besseren Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt. Warum sollte nicht ein französischer Windpark auch für plötzlich gestiegenen Verbrauch in Deutschland eingesetzt werden können? Oder ein österreichisches Wasserkraftwerk für dänische Stromkonsumenten? Der Ausbau von Grenzkuppelstellen und der Abbau von Hindernissen beim grenzüberschreitenden Handel von Strom sind sicherlich die nächsten Aufgaben, um das Potential der europäischen Strommarktharmonisierung zu heben.
Mehr Informationen
Weitere Informationen und Dienstleistungen
Hinweis: Next Kraftwerke übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Der vorliegende Beitrag dient lediglich der Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.